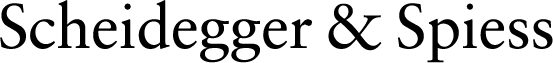An der Peripherie der Netzhaut
Peter Zumthor im Gespräch mit Hélène Binet
Peter Zumthor: Mir gefällt die Vorstellung, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir händisch machen müssen, dass wir nicht alles mit Computern und Maschinen und dergleichen machen können, dass es eine Qualität gibt, die aus der händischen Herstellung resultiert. Wie ist das in der Fotografie?
Hélène Binet: Wie du weisst, bin ich eine überzeugte Verteidigerin der Fotografie. Ich liebe die Praxis der Fotografie und ich glaube ganz fest an die Fotografie als ein Handwerk – und das versuche ich auch jungen Menschen beizubringen: dass es eine ganz besondere Art der Arbeit ist. Auch ich arbeite sehr gerne mit den Händen, und für mich ist jede Aufnahme eine Art Aufführung. Ich muss das Beste von mir geben, und zwar mehrere Tage oder mehrere Stunden lang, jedenfalls solange das Sonnenlicht stimmt. Ausserdem ist das Material ja auch teuer, und es wiegt schwer, deshalb muss ich wirklich präsent sein und mich sehr konzentrieren. Man ist nicht entsprechend konzentriert, wenn man einen Computer zwischen sich und der Welt hat, denn dann fällt der Computer bestimmte Entscheidungen für einen, und das ist ein Verlust für den betreffenden Menschen. Ich glaube, der Zustand, den wir alle bei unserer Arbeit anstreben, ist eine Art Trance, ein Zustand, in dem man Entscheidungen mit einem Teil des Gehirns trifft, der auf eine ganz besondere Art und Weise funktioniert. Deshalb ist es wirklich wie eine Aufführung. Man muss geben – und das hat einen bestimmten Zauber!
Wie bereitest du dich auf diesen tranceartigen Zustand vor?
Indem ich sehr viel gehe! Ich könnte mich natürlich auch vorbereiten, indem ich mich mit dem Architekten vertraut mache und versuche zu verstehen, was ihn antreibt. Doch für mich ist die Hauptsache, dass ich mich an einen Ort begebe und dann dort gehe und gehe. Das Gehen hat diese wunderbare Eigenschaft, dass man mit dem ganzen Körper den Raum erfahren kann und auch die Veränderungen, die dieser Raum unentwegt durchläuft.
Hélène Binet
Hélène Binet ist eine Schweizer Architekturfotografin. In Rom aufgewachsen, lebt sie heute in London. Binet arbeitete als Fotografin mit vielen international bekannten Architektinnen und Architekten zusammen, unter anderem auch mit Peter Zumthor.
Peter Zumthor
Peter Zumthor arbeitet mit seinem rund dreissigköpfigen Atelier in der alpinen Umgebung von Haldenstein in der Schweiz und schuf architektonische Originale wie das Kunsthaus Bregenz, die Therme Vals, das Museum Kolumba Köln, die Gedenkstätte Steilneset in Vardø und derzeit das neue Gebäude für das Los Angeles Museum of Art (LACMA).
Gehen heisst in dem Fall, in dem Gebäude umhergehen, um das Gebäude herum gehen?
Um das Gebäude, in dem Gebäude, durch verschiedene Teile des Gebäudes – was auch immer notwendig ist, um dieses Gefühl zu entwickeln, dass sich da etwas sehr Schönes auftut und entfaltet. Denn das ist es, was ich in meinen Fotos einfangen möchte. Das ist die Eigenschaft, die ich bannen will. Deshalb muss ich zuerst all die Möglichkeiten eröffnen. Ich sage immer, dass Vorbereitung sehr wohl wichtig sein mag, doch ein schöner Ort und ein schönes Gebäude werden mich immer wieder überraschen, und diese Überraschung möchte ich auch in meinen Fotos wiedergeben. Ich werde nie sagen: «Ach nein, das passt jetzt nicht in meinen Plan.» (Lacht) Ich möchte am Ort sein, um diese Überraschung einzufangen. Beim Improvisieren macht man es vielleicht ähnlich. Man muss die Überraschung zulassen.
Du komponierst deine Bilder gleich dort, an Ort und Stelle?
Ja, an Ort und Stelle. Meistens kommt es von selbst, und ich weiss irgendwie, wenn es stimmt. Ich kann ja auch nicht stundenlang dortbleiben und hin und her überlegen, ob ja, nein, ja, vielleicht. Man hat ein Gespür für diesen Moment, wenn es stimmt. Und dieser Augenblick, der ist eben wie ein Zauber.
«Man hat ein Gespür für diesen Moment, wenn es stimmt. Und dieser Augenblick, der ist eben wie ein Zauber.»
«Man hat ein Gespür für diesen Moment, wenn es stimmt. Und dieser Augenblick, der ist eben wie ein Zauber.»
Fotografie ist eine zweidimensionale Angelegenheit, aber das gilt ja auch für Malerei und Zeichnen; dennoch kann man damit auf gewisse Weise in die Tiefe gehen. Wird es dann zur Kunst – wenn man Glück hat? (Lacht)
Ja, kann sein, aber ich mag solche Definitionen nicht so gern. In dem, was ich tue, folge ich meinem Instinkt und Gefühl. Und wenn meine Arbeit dich bewegt, dann liegt es vielleicht daran, dass ich an einen Teil deines Innenlebens gerührt habe, der mit dieser Arbeit im Einklang steht, denn ganz offensichtlich ist es ja mehr als eine blosse Dokumentation.
Du hast deine ganz eigene Handschrift, aber du respektierst auch die Wünsche deines Auftraggebers. Wenn ich dich also bitten würde, eines meiner Gebäude zu fotografieren, dann würde doch mindestens ein klein wenig von meinem Bau darin enthalten sein, oder? (Alle lachen)
Ja natürlich. Ich werde meine Aufnahme ja nicht um Mitternacht oder bei Mondlicht machen und dann sagen: «Bitte sehr Peter, ich habe das Foto gemacht.» Ich bin ja nicht ganz und gar unabhängig, zumindest nicht, wenn ich einen Auftrag habe.
Wärst du gerne unabhängig?
Das ist eine interessante Frage. Ich sehe das, was ich tue, eher so, als spielte ich ein Musikstück. Musikerinnen und Musiker lernen sehr viel aus den Noten, und für mich ist es eine wunderbare Erfahrung, mit einem Architekten zu arbeiten, seine Denkweise zu verstehen und zu versuchen, diese zum Ausdruck zu bringen, auch wenn es sich um eine Fotografie handelt, die nur einen kleinen Teil des Bauwerks zeigen kann. Für mich ist es eine bereichernde Erfahrung, und ich habe nie bezweifelt, dass es die Mühe wert ist.
Ich kann mich daran erinnern, wie ich mich einmal bei dir beschwert, oder vielmehr die Beschwerden anderer an dich weitergegeben habe, dass auf deinen Bildern keine Menschen präsent sind: «Könnten wir nicht ein paar Leute in diesem Raum haben? Wäre das nicht schön?» Und darauf hast du gesagt: «Es sind Menschen da, man kann sie nur nicht sehen.» (Alle lachen) Kannst du dazu etwas sagen?
Nun, dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen möchte ich ja, dass die Betrachterin oder der Betrachter auf den Fotografien ist, es gibt also mindestens eine Person, die präsent ist. Dann gibt es die Belichtungszeiten. Ich arbeite mit sehr langen Belichtungszeiten, das heisst, dass vorübergehende Menschen nicht registriert werden. Aber ich bin nicht radikal. Ich bin nicht Bernd und Hilla Becher. Ich habe einige Fotos mit Menschen darauf gemacht, und das sah alles ganz natürlich aus, weil sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren. Andererseits ist es so: Wenn man Menschen im Bild hat, hat man auch ein Narrativ. Dieses Narrativ aber muss die Wirkung des Bauwerks steigern, und das ist nicht so einfach, weil der menschliche Körper eine starke Präsenz hat.
Kannst du uns etwas zum Unterschied zwischen Schwarz-Weiss- und Farbfotografie sagen – sowohl in deiner eigenen Arbeit als auch in der Fotografie allgemein?
Nun, du weisst ja, die Vorstellung, dass ich nur Bauwerke darstelle, habe ich hinter mir gelassen. Meine Geschichte ist eine andere. Ich bin Fotografin, und ich kann in Schwarz-Weiss fotografieren, wenn ich möchte. Ich wähle die Schwarz-Weiss-Fotografie als mein wichtigstes Ausdrucksmittel, weil ich mich von diesem anderen Ansatz distanzieren möchte – all diese Weitwinkelbilder und dergleichen. Aber ich meine auch, Fotografie soll diese Spannung spürbar machen: dass ein Raum komplex ist und man ihn nicht nur zweidimensional zeigen kann. Manche Fotografen versuchen, das Problem anzugehen, indem sie mehr Farbe einsetzen, Weitwinkelobjektive benutzen und so weiter. Doch ich mache das Gegenteil. Aristoteles fragte sich, warum Geräusche in der Nacht besser zu hören sind. Und es ist ganz bestimmt so, dass Reduzierung das Bild stärker macht. Deshalb ist mir mehr daran gelegen, zwei Dinge richtig gut zu sagen, als daran, so viel wie möglich reinzupacken. Die Ebene des Taktilen ist mir sehr wichtig, und die lässt sich in Schwarz-Weiss einfach besser wiedergeben als in Farbe. Aber ich bin nicht so absolut, und manchmal ergibt sich Farbe wie von selbst, weil es eine Seite der Geschichte ist.
Warum, meinst du, ist das so, dass sich das Taktile besser in Schwarz-Weiss vermitteln lässt?
Die kleinen Schatten, die Textur definieren, sind in Schwarz-Weiss einfach ausdrucksstärker; es gibt auch weniger Ablenkung als bei Farbe. Bei Farbe weiss man nicht, ob es die Farbe ist, die etwas dunkler macht, oder was es ist; bei Schwarz-Weiss hingegen empfindet man wirklich das Volumen und man spürt, was auf der Oberfläche passiert.
Ist Farbe zu dominierend?
Ja, dominierend und ablenkend. Das empfinde ich ganz stark – ich kann es nicht wissenschaftlich beweisen, doch wenn ich dasselbe Foto in Farbe und Schwarz-Weiss sehe, erscheint es mir ganz offensichtlich.
Ja, das verstehe ich. Die Abstraktion hilft uns, andere Dinge wahrzunehmen. Aber du bist nicht gegen Farbe schlechthin?
Nein, überhaupt nicht! Ich lehne Farbe nicht ab, und ich möchte auch nicht, dass meine Art, die Welt zu interpretieren, zu dunkel ist.
Dann lass uns über Schwarz und Weiss reden. Erzähl uns etwas über Schwarz.
Schwarz ist wunderbar, aber es ist die Abwesenheit von Energie. Wenn man an den Anfang zurückgeht, war da Dunkelheit, und dann kam die Sonne. Schwarz hat also diese Eigenschaft des Ungeheuren, wie der Weltraum. Dann ist es so, dass man in dem Augenblick, in dem man an einen Schatten rührt, sofort die Phantasie anregt. Es ist so viel über die Welt der Schatten geschrieben worden, diese andere Welt mit ihren dunklen Konnotationen und allem, was sie darstellt. Aber für mich ist es nicht nur dunkel, es geht auch noch um etwas anderes, und zwar etwa in dem Sinne – nehmen wir zum Beispiel diesen Tisch: Da ist ein Schatten, weil der Tisch einen Schatten wirft. Doch ich sehe nur den Schatten, nicht den Tisch.
Der Schatten spricht also von dem Tisch? Schatten sprechen von Dingen, ohne sie zu zeigen?
Ja, genau. Und sie können einen reinlegen. Man braucht nur dieses alberne Beispiel mit dem Kaninchen zu nehmen, das man mit der Hand darstellen kann. Das kann einen täuschen, aber es kann einen auch an einen anderen Ort transportieren, zu etwas, was anders ist, als es scheint. Die Welt der Schatten ist eine sehr reiche Welt. Natürlich haben wir auch Schatten am Körper und Schatten, die Volumen und Vitalität formen. Und dann haben wir diesen Zwischenbereich von chiaroscuro und penombra – eine Welt ohne Licht, die trotzdem noch eine sehr schöne Welt ist.
Du arbeitest viel mit diesem penombra, mit Dunkelheit, mit Schwarz.
Ja, das versuche ich. Sie gehören zu meiner Palette. Es gibt andere Fotografen, die arbeiten viel mit Weiss, zum Beispiel Walter Niedermayr, er macht wunderschöne Fotografien, die sehr, sehr weiss sind. Er regt die Phantasie auch an, doch mit brennendem Weiss, mit Durchsichtigkeit, mit Helligkeit. Ich bewundere seine Arbeit sehr, aber ich arbeite anders. Es hat nichts mit Logik zu tun, es ist einfach so, wie es sich ergibt, und das ist dunkel. Ich möchte ja nicht obskur sein. Einige der Fotografien in deiner Monografie waren ja in Farbe, so wie in Le Corbusiers La Tourette, wo all diese wunderbaren Rot- und Gelbtöne zu finden sind.
«Wir arbeiten mit der Welt, und die Welt ist unsere Palette – und das Licht. Licht ist sehr wichtig.»
«Wir arbeiten mit der Welt, und die Welt ist unsere Palette – und das Licht. Licht ist sehr wichtig.»
Ich erinnere mich, dass du für mein Buch diese kleinen Farbvignetten gemacht hast, die etwa alle zehn Seiten oder so vorkommen und fast wie ein ordnendes Element funktionieren.
Ja, das stimmt. Ich will dir eine kleine Geschichte von damals erzählen, als ich die Fotos von der Therme Vals gemacht habe: Ich war eines Abends dort, als die Lichter alle ausgeschaltet waren, und ich sass da in völliger Dunkelheit. Man kann nichts sehen, aber man kann riechen. Und wenn man schwimmt, dann fühlt man das Wasser – man fühlt in der Tat alles. Und dann gingen die Lichter an, und ich sah all die Farben. Und da hatte ich tatsächlich das Gefühl, dass der Raum und die Körper uns zuerst in Schwarz und Weiss gegeben wurden, die Farben kamen erst später, als das Licht anging. Haben sie überhaupt existiert, bevor das Licht da war? Nein. Die Farben kamen mit dem Licht. Das war ein sehr wichtiger Augenblick für mich, denn da habe ich begriffen, dass wir eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Dinge haben, wenn wir sie im Licht sehen, dass es das Licht ist, das dem Gehirn die Farben bringt. Und das Auge, das besteht ja auch aus ganz unterschiedlichen Teilen: Wir sehen die Farben mit den Zapfen,
doch das erste, was reagiert, sind die Stäbchen, das sind die Sensoren ganz am Rand der Netzhaut. Einen Sekundenbruchteil lang also vermitteln uns die Stäbchen Bilder in Schwarz-Weiss.
Die Stäbchen für das Sehen in Schwarz-Weiss befinden sich also an der Peripherie der Netzhaut?
Ja, das ist richtig. Alle die Dinge, über die wir uns zu unserer eigenen Sicherheit bewusst sein müssen, sehen wir zuerst in Schwarz-Weiss und dann erst in Farbe.
Und das ist eine wissenschaftliche Tatsache?
Ja, das ist es, aber wir reden hier von einem Sekundenbruchteil, und auch wenn ich nicht weiss, ob wir diesen Effekt irgendwie ausnutzen können, bin ich doch froh zu wissen, dass es das ist, was passiert.
Was ist der Inhalt der Fotografie?
Nun, wir arbeiten mit der Welt. Wir machen nicht etwas Neues wie beispielsweise eine Skulptur, wo vorher nichts war. Wir arbeiten mit der Welt, und die Welt ist unsere Palette – und das Licht. Licht ist sehr wichtig.
Und das Dunkel?
Ja, das Dunkel auch. Aber es gibt gar kein Licht ohne Dunkel. Das ist wie mit der Stille in der Musik. Man braucht die Stille, um ein Musikstück zu strukturieren. Das ist bei uns dasselbe mit dem Licht. Wir haben diese Welt, die manchmal überwältigend ist, und es ist die Aufgabe des Fotografen, nicht nur darzustellen, was vorhanden ist, sondern es auch weiterzutragen: zu einer Nachrichtenagentur etwa, oder zu Menschen, die weit entfernt sind, oder in ein Familienalbum – es gibt so viele mögliche Verwendungen für die Fotografie. Ich glaube, das ist ein Grund, weshalb ich Fotografie so liebe: weil es so viele verschiedene Arten und Weisen gibt, sich ihr zu nähern. Fotografie ist auch ein ganz einfaches Werkzeug. Sie ist nicht schwierig. Man braucht nicht etliche Jahre, um sie zu erlernen. Obwohl das vielleicht auch ein Nachteil ist – dass ein Bild so schnell hergestellt werden kann. Es geht eigentlich darum, dass man sagt: «Nein, nein, nein», und dann endlich: «Ja!», weil man es auf einmal hat. Es ist einfach da.
«Für mich geht es bei Fotografie darum, das Leben zu feiern.»
«Für mich geht es bei Fotografie darum, das Leben zu feiern.»
Es geht also um die Gegenständlichkeit. Aber es geht auch um viele andere Dinge, um die Welt und die Betrachtung der Welt.
Für mich geht es bei Fotografie darum, das Leben zu feiern. Ich brauche die Welt. Ich brauche auch Menschen, ich brauche die Sonne. Und ich brauche die Natur. Wenn ich mit meinem Stativ und meiner Kamera und meinem ganzen Zubehör hinaus in die Welt gehe, dann mache ich auf jeden Fall etwas ganz Physisches. Aber ich feiere dabei auch das Leben.
Auszug aus: Dear to me, © 2021 Peter Zumthor und Verlag Scheidegger & Spiess AG, Zürich
Lesen Sie weitere Gespräche von Peter Zumthor mit seinen Gästen
Dear to Me
Dear to Me
Weitere Bücher von und über Peter Zumthor
Peter Zumthor Therme Vals
Peter Zumthor Therme Vals
Peter Zumthor spricht über seine Arbeit
Peter Zumthor Talks About His Work
Zumthor sehen. Bilder von Hans Danuser
Die Geschichte in den Dingen
A Feeling of History
Niederdorfstrasse 54
8001 Zürich
Schweiz
+41 (0)44 262 16 62
info@scheidegger-spiess.ch